 Stadtplan von Berlin aus dem 19. Jahrhundert – Quelle: Wikimedia
Stadtplan von Berlin aus dem 19. Jahrhundert – Quelle: Wikimedia
Eins. Von der Orientierung.
Seitdem mir mein Vater seinen Stadtplan zeigte, bin ich verliebt in Karten. Denn sie zeigten mir die Welt, die ich kannte: Die Strassen, Plätze und Wege, auf denen ich täglich unterwegs war und auch wichtige Gebäude wie Schulen und Kirchen. Ich war fasziniert, das vertraute wieder zu erkennen in dieser doch ganz anderen Darstellung. Was Abstraktion war, wusste ich damals noch nicht, und mein Vater wahrscheinlich auch nicht. Es war klar, dass ich diesem Plan vertrauen könnte, denn das alles so war, wie es da aufgezeichnet war, stimmte ja mit meiner eigenen Erfahrung überein. Und dennoch hatte diese Karte eine weitere faszinierende Eigenschaft, die ich sehr bald entdeckte. Denn sie zeigte auch Orte, Strassen und Plätze, die ich noch nicht kannte. Mehr noch, sie zeigte mir die Wege dorthin. Ich hatte nur den Strassen zu folgen und mich an entscheidenden Stellen, Kreuzungen, Weggabelungen und desgleichen mehr, richtig zu verhalten. Wie diese Wegpunkte aussahen, konnte ich der Karte entnehmen – jedenfalls mehr oder weniger. Auch Entfernungen waren prima abzuschätzen, denn wie lang die mir vertrauten Wegstrecken waren, wusste ich ja. Wenn also eine Strecke also ein mehrfaches der Entfernung ausmachte, die ich kannte, war in etwa klar, was auf mich zukommen würde. Ich liebte diesen Stadtplan und bat häufig darum, ihn ausleihen zu dürfen. Ich klemmte ihn hinten auf meinen Fahrradgepäckträger und fuhr los. Die Route hatte ich mir tagelang eingeprägt. Sollte einmal Unsicherheit aufkommen – und das passierte gelegentlich tatsächlich – brauchte ich nur anzuhalten und mich auf der Karte vergewissern, wo ich gerade war. Zumal es noch einen weiteren enormen Vorteil dieser Karte gab. Die Strassen und Plätze waren nicht nur abgebildet, sondern auch mit ihren Namen verzeichnet. Ich konnte also jederzeit das Strassenschild mit dem Karteneintrag vergleichen. Meistens waren es Kleinigkeiten, eine Strasse zu früh abgebogen oder an einer Abfolge mehrerer Kreuzungen die falsche Ausfahrt erwischt. Ich war meistens nur knapp neben dem eigentlichen Weg. Und in den Fällen, in denen ich nun in einer offensichtlich ganz falschen Gegend war, gab es noch eine weitere, wirklich geniale Kartenfunktion. Wenn ich nur irgendwo den Namen der Strasse, in der ich mich gerade befand, ausfindig machen konnte, gab es für alle Strassen der Stadt ein Verzeichnis, alfabetisch geordnet. Ich brauchte dann nur noch die Strasse im Verzeichnis heraussuchen, und die dahinterstehende Buchstabenkombination gab mir wieder vollständige Orientierung. 17 B 4-5 bedeutete zum Beispiel, dass die gesuchte Strasse auf Seite 17 im Quadrat B 4 bis zum Quadrat B 5 verlaufen würde. Dennoch kostete es mich oftmals einige Mhe, unter dem Gewimmel der vielen kreuz und quer verlaufenden Strassen die richtige zu finden. Aber dennoch verursachte das keine Unsicherheit. Auch wenn es einmal länger dauerte, eine Strasse auf dem Plan tatsächlich zu finden, gab es nie einen Fehler. Im Gegenteil, der Stadtplan schien perfekt, fehlerfrei, unfehlbar zu sein. Mit dem Stadtplan in der Hand war die ganze Stadt mein. Und von diesen Möglichkeiten machte ich exzessiv Gebrauch. Damals im Jahr 1978: ich war dreizehn Jahre alt, hatte vor zwei Jahren Radfahren gelernt und besaß ein blaues Klappfahrrad. So gut wie jeden Sonntag war ich unterwegs – und meistens bis zur Grenze. Denn die Stadt Westberlin war zu jenen Zeiten vollständig von einer Mauer umgeben.
Gebunkert hatte ich zu jenen Zeiten nichts. Ich hatte die Karte dabei, häufig, aber nicht immer, eine Wasserflasche und manchmal dachte ich daran, einen Pullover mitzunehmen. So war ich jeden Sonntag für mehrere Stunden dreißig oder vierzig, manchmal auch fünfzig Kilometer und mehr unterwegs. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass mir was gefehlt hätte.
Die Begeisterung für diese Touren liess nach, als ich nach einiger Zeit nun wirklich jede Ausfallstrasse Berlins – und sei sie noch so entfernt und abgelegen gewesen wie die in Kladow oder Frohnau – abgefahren war und jedesmal aufs neue die Fahrt an der Mauer endete. Fr einen dreizehnjährigen allein in die DDR einzureisen oder die Transitstrecke zu befahren, war damals nicht möglich und wäre mir auch sicher nicht in den Sinn gekommen. Die Interessen verlagerten sich und ich interessierte mich mehr für Menschen, Aktionen, Projekte und Veranstaltungen, und auch hier waren meine erworbenen Kenntnisse von unschlagbarem Vorteil. Hatte ich erst mal die Adresse, konnte ich einwandfrei feststellen, wo ich hin musste und welcher Weg der geeignetste war. Die meisten Hauptverkehrsachsen kannte ich ja, so dass ich mir den Weg zu einem bestimmten Ort zum grossen Teil aufgrund meiner Erinnerungen vorstellen und so einprägen konnte. Neu war dann nur noch das letzte Stck des Weges.
Wichtig ist auch der Norden. Genaugenommen gar nicht der Norden, sondern die Ausrichtung aller Karten an diese Richtung. Norden ist oben, Westen links, Osten rechts, Süden unten. Auch das wäre nun an und für sich belanglos, aber in Kombination mit dem Verlauf der Sonne ergibt sich daraus eine wichtige grundsätzliche Orientierung. Auch darauf hat mich mein Vater hingewiesen. „Im Osten geht die Sonne auf, im Sden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehn, im Norden ist sie nie zu sehn!“ Wenn mich mein Vater darauf aufmerksam machte, stimmte das auch irgendwie immer. Wenn wir unterwegs waren, redete mein Vater öfter davon. „Guck mal, es ist nachmittags, wir fahren Richtung Osten, wir haben die Sonne im Rücken!“ So und anders wurde mir klar, wie das mit dem Stand der Sonne und den Himmelsrichtungen zusammenhing. Das übertrug ich dann auch auf meine sonntäglichen Radfahrten und überlegte immer für mich selber, aus welcher Richtung die Sonne scheinen würde, wenn ich unterwegs war. Dieser Sinn für die grundsätzliche Orientierungsrichtung ist so entstanden und war im Grunde eine Art Ergänzungs- und Überprüfungssystem zur Orientierung anhand der Karte.
 historische Aufnahme Köpenick, Schlossinsel, Brücke – Quelle: WikimediaZwei. Ambitionen
historische Aufnahme Köpenick, Schlossinsel, Brücke – Quelle: WikimediaZwei. Ambitionen
Erst sehr viel später, da war ich schon fast Mitte zwanzig, habe ich das Segeln gelernt. Und plötzlich wurden Details aus dem Stadtplan, die vorher eher nebensächlich und bestenfalls schön blau waren, zu einem wichtigen Bezugspunkt. Blau, das war die Farbe der Seen, auf denen ich segeln konnte und die Farbe der Wasserstrassen, die einen See mit einem anderen verbanden. Es gab Gewässer, die waren klein und ohne jede Verbindung zu anderen, es gab Gewässer, die waren grösser und vor allem, miteinander verbunden. Ich bekam einen alten Wasserwanderatlas in die Finger und begriff, dass ich, wählte ich für meine Segelei einen Punkt, der mit anderen blauen Punkten verbunden war, ich nahezu unendlich viele Möglichkeiten haben würde, in meiner Stadt und in meiner Umgebung auf dem Wasser unterwegs zu sein. Zu meinem ersten Boot und zu meinem ersten Liegeplatz bin ich eher zufällig gekommen – aufgrund einer Anzeige in der Zweiten Hand, der damals gebräuchlichen Kleinanzeigenzeitung. Eine Piratenjolle in Schmöckwitz. Es ist dann doch eine Yxilon geworden, aber das ist eine andere Geschichte. Aber Schmöckwitz war gut: Segeln auf Zeuthener See und dann weiter zum Ziegenhals und zum Krossinsee, oder geradeaus Richtung Wildau. Unter der Brücke durch zum Seddinsee, dort über den Gosener Kanal nach Klein Venedig und zum Mggelsee, oder in die Grosse Klampe, oder den Langen See hinauf bis nach Köpenick und auch von dort aus zum Müggelsee. Ein Standort und vier Optionen – das war und ist bis heute spektakulär. Dennoch war mein Segelalltag in diesen ersten Jahren im Grunde völlig unspektakulär. Während ich mir die verschiedensten Tourvarianten im Kopf überlegte, lief es praktisch immer darauf hinaus, dass ich vormittags in eine Richtung hinaussegelte und so weit wie möglich kommen wollte. Als ich Endpunkt angelangt war, schlief dann der Wind ein – was nachmittags ziemlich regelmässig der Fall war. So wurde der Rückweg eine wahre Geduldsprobe, und nicht selten habe ich bis in die Nacht hinein die letzten Kilometer paddelnd auf dem Wasser verbracht.
Auf der Jolle zu schlafen, das machte ich nur in Ausnahmefällen, denn irgendwie schien mir das ganze Boot nicht für Wandertouren ausgelegt. Es gab zwar irgendwo in meinem Segelschrank noch einen passenden Motor, aber keine Halterung dafür, und irgendwas hielt mich auch davon ab, das weiter zu verfolgen. Denn der Motor war ein alter DDR-Quirl, und es gab auf dem Segelgelände eigentlich nur Geschichten darüber, das dieser Motor nicht funktioniert. Also, er funktionierte im Prinzip schon, aber es bedurfte offenbar vieler Tricks und Kniffe, ihn zum Laufen zu bringen und eine der hervorstechendsten Eigenschaften dieses Motors schien darin zu bestehen, gerade in wichtigen Situationen auszufallen oder nicht anzuspringen – zum Beispiel in Schleusen. So oder so ähnlich verliefen jedenfalls die meisten aller Gespräche zum Thema Motor, wirklich ermutigend. Wie auch immer – ich segelte schön in einem klar definierten Radius und am späten Nachmittag abend war immer paddeln angesagt. So konnte es nicht bleiben.
 Tour de France 2006, Prolog – Quelle: WikimediaDrei. Der Prolog.
Tour de France 2006, Prolog – Quelle: WikimediaDrei. Der Prolog.
Eines Tages lernte ich Robert kennen und der lud mich ein, auf seinem Holz-Jollenkreuzer Susi mitzusegeln. Im Vergleich zu meiner offenen Jolle war der Jollenkreuzer ein wahres Raumwunder. Eine riesige, regen- und windsichere Kajüte, riesiger Stauraum für Bier, Pfänder und Segelsachen, überall Schapps und Backskisten für tausenderlei Plunder. Kein Vergleich zu meinen zwei Stauräumen vorne und achtern, die eigentlich immer dann schon voll waren, wenn nur das Allernötigste dabei war. Wir segelten und tranken fulminant, und mir war klar, ein Jollenkreuzer müsste es schon sein. Und genauso klar war aber auch, dass ein Schiff aus Vollholz nicht in Frage kommen würde, denn die Menge all der zu pflegenden, schleifenden, streichenden, auszubessernden, gammelnden, rottenden und allesamt belastenden Holzflächen schien schier unendlich zu sein. Robert jammerte auch und murmelte etwas von 2 Stunden Arbeit, eine Stunde segeln. So oder noch ungünstiger sei das Verhältnis von Arbeit und Vergnügen. Und Robert sah nicht so aus, als hätte er die Arbeit erfunden. Das Vergangene schon eher.
Wie dem auch sei, ich hatte also eines Tages einen eigenen Jollenkreuzer, und für den ersten Sommer planten wir, dass heisst meine damalige Freundin, ihr Hund und ich eine gemeinsame Tour von mindestens drei Wochen. Ich glaube, wir wollten zur Müritz und dann weiter zu den grossen Mecklenburgischen Seen. Bemerkenswert war aber die schier unendliche Menge an Vorräten, die wir glaubten, dafür benötigen zu müssen. Der Hund brauchte jeden Tag eine grosse Dose Hundefutter, also kauften wir zwei ganze Paletten a zwölf Dosen ein – vierundzwanzig Dosen Hundefutter, allesamt im Vorschiff verstaut. Ich erinnere mich noch, dass ich jeden Abend zur Hundemahlzeit mich bis ganz nach vorne wühlen musste, um unter ungeheueren Anstrengungen aus der tiefsten untersten Ecke eine Dose herauszuwühlen. Wenn die Sorte nicht genehm war – der Hund sollte schliesslich abwechslungsreich ernährt werden -, konnte sich das beliebig oft wiederholen, bis ich eine ‚genehme‘ Sorte am Wickel hatte. Dazu kam noch ein ganzer zwölf Liter Eimer – mit wasser- und luftdichtem Verschluss – für das Trockenfutter, und, wenn ich mich recht erinnere, noch ungezählte Mengen an Leckerlis, Kaustangen und sonstigen abartigen Tierfuttersnacks für den Hund. Hundedecken, Hundeschwimmwesten und Hundespielzeug lasse ich hier unerwähnt. Dann die Sachen für die Menschen. Wir hatten im Frühjahr einen Zweiflammenherd in der Kajüte samt Deckel und Verschluss montiert und entsprechend ambitioniert waren unsere Planungen. Wir konnten richtige Gerichte zubereiten und kochen. Nix von wegen Eintopf. Also kauften und schleppten wir heran Beutelweise Kartoffeln, Zwiebeln, Reis, Spagehtti, Nudeln und Kartoffelpree. Dazu Milch, Bohnen, Sossenbinder, Pilze im Glas, Bohnen, Eier, Knoblauch, Ttensuppen für Zwischendurch, Tomatenmark, geschälte Tomaten, Dauerwurst, Käse, Scheibletten, Konservenfleisch, Marmeladen, Honig, Tee, Kaffee sowie ein oder zwei Brote. Schokoladen, Erdnsse, Rosinen, Walnsse und Studentenfutter. Müsliriegel, Raider, Twix, Mars und Snickers. Dazu an Gewrüzen Salz und weisser sowie schwarzer Pfeffer, Paprika, Rosenpaprika, Thymian, Curry, Rosmarin, Knoblauch und Grillgewürz sowie Gewürzkräuter. An Getränken pfundweise Kaffee, dann verschiedene Sorten Tee, Selters, Säfte, erhebliche Mengen von Bier, und, wenn ich mich recht entsinne, auch Wein sowie eine kleine Flasche Vodka. Das Bier war an einer besonderen Stelle verstaut, in der Plicht, der Teil des Bootes, der beim Segeln der Aufenthaltsort ist zum Bedienen der Leinen und des Ruders. Unter den Bodenbrettern verstaut, quer zur Schiffsrichtung, die schmalere Öffnung nach aussen gerichtet, säuberlich aneinander gereiht auf der Backbord- und auf der Steuerbordseite, bestimmt jeweils zehn oder zwölf Flaschen, zwischen zwanzig und vierundzwanzig insgesamt. Mit all dem war das Boot gut geladen, beinahe überladen. Denn ähnlich üppig wie die Verpflegung, im Grunde auf Vorrat eingekauft, war auch die übrige Ausstattung. Leinen, Fallen, Schrauben, Winkel, Schäkel, alles was nur ansatzweise hätte kaputtgehen können – die facto aber nie kaputt ging, war doppelt und dreifach an Bord vorhanden. Dazu Unmengen von Werkzeug. Kleidung, Maskottchen, Bücher, Karten, Nähzeug und was weiss ich nicht alles.
Diese Art der Urlaubsvorbereitung führte regelmässig dazu, dass wir, trotz sehr frühen Aufstehens, den ganzen ersten Tag unseres Urlaubs vollständig mit Einkaufen, Transport und Laden bzw. Umladen des Schiffes beschäftigt waren. Es war regelmässig abend und dämmerte meist schon, bis wir alles soweit verstaut hatten. Damit standen wir immer vor der Frage: Lohnt es sich eigentlich noch, heute aufzubrechen? Da wir einhellig der Meinung waren, dass es bei einer Bootstour nicht sein kann, gleich am ersten Tag im Hafen zu bleiben, sind wir dann doch noch regelmässig aufgebrochen. Meistens bestand dieser Aufbruch darin, dass wir die Leinen los machten und 50 Meter weit unter Motor zum gegenüber liegenden Ufer fuhren und dort festmachten. Wir waren losgekommen, wir waren an einem anderen Ort wo sonst immer, der Urlaub hatte begonnen, großartig.
Seit jener Zeit beginnt eigentlich jede meiner Reisen mit einem solchen Prolog. Ausschlafen, in Ruhe alles vorbereiten, einpacken und laden, und dann, wenn es abend geworden ist, aufbrechen.
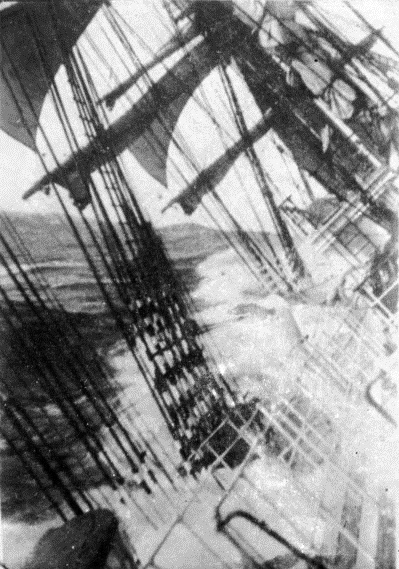 Unbekanntes Schiff bei Kap Hoorn – Quelle: WikimediaVier. Sucht und Suche.
Unbekanntes Schiff bei Kap Hoorn – Quelle: WikimediaVier. Sucht und Suche.
Allein vom Proviant und der Ausrüstung hätten wir wochenlang, ja monatelang unterwegs sein können, ohne irgendwo anlegen und einkaufen zu mssen. Das war die Theorie. In der Praxis war das völlig anders, und das kam so. Unerklärlicherweise waren die Biervorräte nach spätestens zwei Tage immer alle, und das, obwohl der Skipper immer nur mit jeweils einem Bier gesichtet wurde und die Skipperin im Grunde nicht trank, oder nur minimal. Der Skipper hatte aber die Angewohnheit, die Flaschen schnell zu leeren, und zwar andauernd. Dafür gab es anscheinend dringende nautische Gründe. Der Skipper sprach dann beispielsweise von einem Ablegebierchen. Minuten später was das Segel-setz-Bierchen an der Reihe, dann das Segel- oder Wendebierchen bei drastischen Kursänderungen. Berechtigt waren auch die Schleusenbierchen. Ein Bierchen vor der Schleuse, eines bei der Schleuse, und dann schon gleich ein Drittes nach der Schleuse. Manchmal folgten mehrere Schleusen hintereinander weg. Spätestens am Anfang des zweiten Tages also reklamierte der Skipper, dass irgendwo zum Einkaufen angelegt werden msse, und der Grund dafür war aber ein ganz anderer. Natürlich musste der Hund Gassi gehen, oder aber für die geplante Mahlzeit fehlte etwas ungeheuer wichtiges, was unbedingt noch eingekauft werden müsse. Dinge wie der Parmesankäse für die Spaghetti, oder Senf für die Wurst. Tatsächlich kamen dann beutelweise leere Bierflaschen zum Vorschein, die im Laden eins zu eins ersetzt worden sind. Das Trinken selbst war eher unauffällig – mit einem schnellen Griff war das Bodenbrett angehoben, die leere Flasche fand ihren Platz am hinteren Ende – es machte Kling -, und mit einem zielsicheren Griff wurde am vorderen Ende eine neue entnommen. Klorrklorr – Kling war das Geräusch der nachrollenden und aneinander stossenden Flaschen im Boot, ein Geräusch, das sich mehrmals am Tag wiederholte. Über den Gesamtbestand an Flaschen schien der Skipper ein inneres Logbuch zu führen, denn er fühlte sich immer ein wenig angespannt und unwohl, wenn über die Hälfte des Flaschenbestandes nicht mehr aus vollen Flaschen bestand.
Anders als auf anderen Booten gab es auf diesem Jollenkreuzer nach dem Anlegen aber keine alkoholischen Exzesse, warum auch? Nach dem Anlegen gab es das Ankunfts-Bierchen, dann ein Bierchen zum Landgang, ein Bierchen zum Essen machen, ein Bierchen zum Essen und ein Bierchen zur guten Nacht – und der Tag war gelaufen. Ohne Pöbeln, ohne Torkeln, ohne Lallen und die sonst blichen negativen Begleitumstände der nautischen Trunksucht. Am nächsten Morgen ging das Spiel von vorne los. Kaffee zum Frühstück und dann zum Ablegen den Rest vom Kaffee, aber dann doch schon bald des erste Bierchen. Wahrscheinlich musste wieder ein Segel gesetzt werden. Der Skipper ist dann mit diesem Kurs beinahe auf Grund gelaufen, und eines Tages war Schluss mit diesem Bierchen – Segeln. Überhaupt gab es keinen Alkohol an Bord mehr, und die Bunker-Situation veränderte sich von diesem Zeitpunkt an erheblich. Denn nun wurden auch alle anderen Dinge in Frage gestellt. Braucht es überhaupt für drei Wochen Lebensmittel, wenn spätestens nach zwei Tagen wieder ein Supermarkt in der Nähe ist? Braucht wirklich unzählige Dosen Konserven aller Art – Nudeltopf, Feuertopf, Kartoffelsuppe mit Würstchen, Reistopf, Gulasch, Bundeswehr-Reserve – wenn die Mehrzahl am Ende der Saison bestenfalls ohne Etikett und angerostet im Schiffsbauch vor sich her gammeln und dann im nächsten Jahr als Überraschungskonserve weiter verwendet werden müssen? Braucht es wirklich den Fünf-Kilo-Zwiebelbeutel aus dem Sonderangebot, wenn zwei Drittel der nicht aufgebrauchten Zwiebeln aufgrund der Hitze lange grüne Triebe gebildet haben? Was wird aus dem fast unverbrauchten Beutel, in dem fast alle Kartoffeln angefangen haben zu Keimen? Dem Kilo weich und unappetitlich gewordener Karotten? Und und und.
In dem Maße, in dem das mit dem Bunkern aufhörte, nahm das Segeln wieder zu. Denn in Wahrheit wurde in dieser Zeit zwar viel vom Segeln geredet, aber die Logbcher sagen etwas anderes aus. Dann fühlte sich der Skipper nicht und es wurde motort, dann wurden immer wieder Häfen angesteuert und ganze Vor- und Nachmittage mit Einkaufen und Bunkern verbracht, dann war entweder zu viel oder zu wenig Wind oder zu viel oder zu wenig Wasser unter dem Kiel oder dies und das und jenes an Land zu besichtigen ….
 Sonnenuntergang am Goldenen Horn, Istanbul – Quelle: WikimediaFnf. Vom Ankommen.
Sonnenuntergang am Goldenen Horn, Istanbul – Quelle: WikimediaFnf. Vom Ankommen.
Wenn ich heute einen Törn mache, achte ich darauf, dass genügend Kaffee, Tee, Wasser, Selters und Honig vorhanden ist und dass der Brennstoff für den Herd für einige Zeit reichen sollte. So habe ich auf jeden Fall genug zu trinken, kann mir warme Getränke zubereiten und bin für mehrere Tage unabhängig. Was das Essen angeht, sehe ich nach, was zu Hause noch im Kühlschrank vorhanden ist und beschränke mich auf einige grundlegende Dinge. Tomaten und Zwiebel. Butter und ein Vollkornbrot. Ãpfel und Bananen. Das reicht eigentlich schon, um mehrere Tage zu überstehen. Und wenn ich Lust habe, irgendetwas besonderes kochen oder essen zu wollen, steuere ich einen Hafen an. Es gibt in Deutschlands Binnengewässern sicher keinen Punkt, wo nicht innerhalb von einem Tag ein Ort erreichbar ist, in dem Lebensmittel – häufig in sehr grosser Auswahl eines Supermarktes – nachgekauft werden könnten. Und das gilt selbst für Dogmasegler, also Menschen, die immer und grundsätzlich segeln, wo segeln möglich ist, und das selbst bei Flaute. Denn – ein bisschen Wind ist immer.
Bunkern macht ein Boot schwer und träge. Ein volles, beinahe berladenes Boot segelt weder gut noch gerne. Es klappert, rutscht, döngelt, klirrt, scheppert und gnitscht ja doch irgendwo. Ein überbunkertes Boot belastet den Skipper, weil alles kontrolliert, überprüft, gesichtet und verbraucht werden muss. Verbrauch nicht um des Verbrauchens, des Geniessens willen, sondern Verbrauch als Massnahme, Dinge vor dem Verfall bewahren, retten zu wollen, ja zu müssen. Wie krank ist das denn? Beim Segeln nehme ich ab und erfreue mich an der Intensität des Einfachen. Der Tomate, mit Salz und Pfeffer bestreut. Dem Kaffee, mit frischer Milch veredelt. Dem einheimischen Obst aus frischer Ernte. Es ist auch nicht schlimm und häufig gar nicht teuer, irgendwo eine Kleinigkeit essen zu gehen. Und vor allem freut sich mein Körper. Die Völlerei des grossstädtischen Lebens ist eine Kompensationsleistung zivilisatorischer Defizite, kein wirkliches Körperbedürfnis. Auf dem Wasser will mein Körper dieses alles nicht. Er möchte einfache Dinge, klare Dinge. Und vor allem wenige Dinge. Die Erschöpfung nach einem langen, intensiven Segeltag ist befriedigender als die nach einer Völlerei mit drei oder vier Gängen zweifelhafter Qualität.
Setze Dein Segel, solange der Wind günstig ist. Dieser Postkartensatz beinhaltet eine tiefe Wahrheit. Die Geschichte der Segelei ist eine Geschichte der Flexibilität, der Mobilität und eines Lebens mit dem Wind und den Wellen, nicht gegen diese Gewalten. Das Haltung des Bunkerns widerspricht diesem Prinzip. Wer unterwegs sein will, braucht leichtes Gepäck und keine schweren, erdrückenden, das Fortkommen behindernden Bleigewichte. Entscheidend ist nur das wenige Unverzichtbare. In dem Masse, wie ich mich auf das Segeln konzentriere, verliert das Bunkern für mich an Bedeutung. Mehr und mehr. Ja, je weniger ich bunkere, desto leichter und freier fühle ich mich, aufzubrechen, unterwegs zu sein, mich auf das einzulassen, was auf mich zu kommt. Dort, wo ich hinkomme, wo ich ankomme, finde ich alles das, was ich brauche. Ich habe fast ein Jahrzehnt lang gebraucht, um das zu lernen, zu verstehen.
Und dann bin ich wieder bei meiner Ausgangssituation, bei den Plänen. Wieder und wieder studiere ich die nautischen Karten, denn sie zeigen mir die Wasserwege, die Seen, Küsten, Kanäle, Flsse und Inseln. Die, die ich kenne und die, die ich noch nicht kenne. Und sie zeigen mir auch den Weg dorthin. Um dort hin zu kommen, brauche ich nichts zu bunkern, sondern brauche nur mit zu nehmen, was wirklich erforderlich ist.
Berlin, 02.05.2011
Aktualisiert am 27. 09. 2017 um 13:01 Uhr

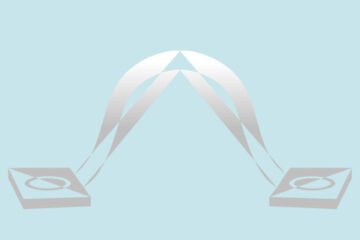
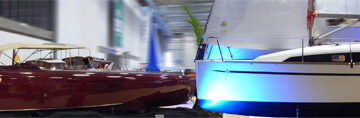

1 Kommentar
Die Kommentare sind geschlossen.